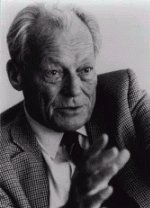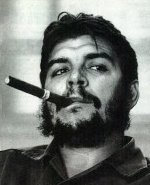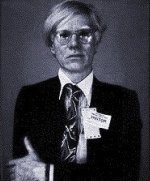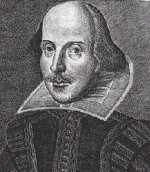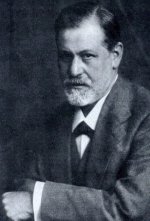|


Home

 Ikonographie der Monochromatik
Ikonographie der Monochromatik

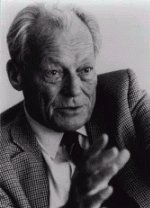
Willy Brandt: Startzeichen für das Farbfernsehen

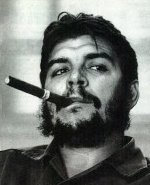
Che Guevara: Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche

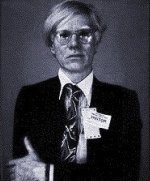
Andy Warhol: Chromatischer Analphabet mit stark begrenztem Farbspektrum

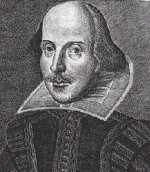
William Shakespeare: Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht, wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht

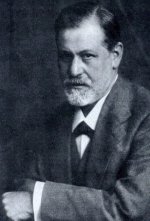
Sigmund Freud: Rotdominante Farbgestaltung chiffriert unverarbeitete Liebesbeziehungen mit erotischen, ödipalen oder inzestuösen Inhalten

Lesen Sie auch:
Polychromatische Barbaren traktieren Web-User
Eine polemische Attacke auf das Farb-Unwesen im Internet

|
 |
Webdesign:
Dominanz des Kunterbunten psychoanalytisch erklärbar
Fangen wir von vorne an: Willy Brandt gab 1967 mit einem Knopfdruck das
offizielle Startzeichen für den Beginn des Deutschen Farbfernsehens. Die
Mattscheibe wurde bunt und 60 Millionen Schwarz-Weiß-Seher zwischen
Flensburg und München lechzten nach der Fernseh-Farbe wie ein Dürstender
in der Wüste nach Wasser. Farbe war für sie ein lang herbeigesehnter
Befreiungsschlag aus der Tristesse des grauen Fernseh-Alltags der 50er
und 60er Jahre.
Mehr noch: Der Start ins Farbfernsehzeitalter war 1967
gleichzusetzen mit dem revolutionären Aufbegehren einer ganzen
Generation. Che Guevaras "Seien wir realistisch, versuchen wir das
Unmögliche" war auch bei der Revolte gegen die
Schwarz-Weiss-Vorherrschaft die siegreiche Insignie der farblich zu kurz
gekommenen Couch-Potatoes. Mit der Unersättlichkeit einer
polychromatischen Nymphe sogen die Westdeutschen alles gierig in sich
auf, was im Deutschen Farbfernsehen an Schwachmatik-Entertainment bunt
und schrill daherkam. Nicht wenige Farbjunkies schluckten vor der Klotze
eine visuelle Überdosis bunter Smarties oder gaben sich im abendlichen
Hauptprogramm den goldenen Schuss.
Hinsichtlich der Qualität des farblich Gebotenen waren die Deutschen
nicht zimperlich. Denn was die damalige Kamera- und Röhrentechnik
lieferte, war oft ein Bild des farblichen Grauens. Denn die
Farbfernseher der ersten Generation hatten keine chipgesteuerte
Farbsättigung und entbehrten auch jeder automatischen Helligkeits- und
Kontrastregelung. So flimmerte jedes Gerät mit einem individuellen
Farbstich, der vom Nutzer je nach Vorliebe ins Blaue, Rote oder Grüne
intensitätsreich variiert werden konnte. Das war seinerzeit eine
allgemein akzeptierte Masseneinstellung. Waren die Menschen ja froh,
dass sie überhaupt Farbe hatten. Heutige Fernseh-Zuschauer, die im
Vergleich dazu nahezu brillant abgemischte Farben bei ihren
Flimmerkisten vorfinden, würden einen Apparat mit so einer miesen
Farbwiedergabe sofort aus dem Fenster schmeißen.
Entsprechend anspruchsvoll eingestellt wechseln die
Pantoffelkino-Besitzer von heute in die kunterbunte
Boulevard-Kolorierung des Internets. Schockiert von den fluoreszierenden
Farben des Computerbildschirms verstehen sie die Farbenwelt nicht mehr.
Denn was manche Webdesigner an beißender Farbenvielfalt (disharmonischer
Polychromie) anbieten, schreit zum Himmel. Dagegen waren die Popkünstler
der 60er Jahre chromatische Analphabeten mit stark begrenztem
Farbspektrum.
Heute scheinen die Bildschirm-Farbmischer vor nichts
zurück zu schrecken. Unzählige Hobby-Surfer fühlen sich offensichtlich
berufen, eine Webseite nicht nur anklicken, sondern auch selbst
entwerfen und gestalten zu können. Strafrechtlich gesehen handelt es
sich dabei meistens um eine unzulässige Entfernung vom Unfallort. Das
neurotische Homepage-Outing von Privatpersonen ist eine pathologische
Zeiterscheinung mit wachsender Beliebtheit. Unzählige Knalldeppen reden
sich ein, dass sie sich in hemmungsloser Farbenfreude, schwadronierender
Offenheit und mit talentfreien Charaktermerkmalen der weltweiten
Cyber-Space-Community präsentieren müssen. Dieser virtuelle
Exhibitionismus verwandelt Internetportale in visuelle Geisterbahnen und
Grusel-Kabinetts des postmateriellen Virturalismus.
"Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir
nicht. Und wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht." Dieser berühmte
Shylock-Monolog von Shakespeare beschreibt die Befindlichkeit jener
Web-User, die zwar hart im Nehmen, jedoch in ihrem tiefsten Innern
schwer verletzt sind. Verletzt ist ihr ästhetisches Empfinden, weil ihre
Sehnerven ständig mit der polychromen Disharmonie der Layout-Dilettanten
traktiert werden: Das, was der Schmierenkomödiant in Ernst Lubitschs
Film "Sein oder Nichtsein" mit Shakespeare gemacht hat, das machen diese
Webdesigner mit den Web-Usern.
Dabei ist unbestritten: Für polychrome
Psychopathen ist das Internet das falsche Forum für das tabulose
Ausleben ihrer seelischen Defekte. Mittlerweile ist die grundsätzliche
Affinität zwischen Webdesign und Entwicklungspsychologie evident.
Psychotherapeuten sehen im Webdesign eine Metapher, die in einer
symbolischen Weise persönlichkeitsspezifische Elemente aufgreift, die
insbesondere mit lebensgeschichtlich relevanten Konflikten
zusammenhängen.
Die psychoanalytische Praxis fand in diesem Zusammenhang
entsprechende diagnostische Kriterien: So verarbeiten stark
rationalisierende bzw. zwanghafte Persönlichkeiten bei der
Website-Gestaltung Konflikte zwischen Über-Ich und Es. Dabei werden,
wahrscheinlich als Reaktionsbildung auf die Rigidität des übermächtigen
Über-Ichs, häufig abnorme (psychopathische) Phantasien zum Ausdruck
gebracht. Ergebnis ist dabei fast immer eine auffällige farbliche
Gründominanz bei der Website-Gestaltung. Affektabile bzw. "hysterische"
Persönlichkeiten bevorzugen dagegen eine rotdominante Farbgestaltung
beim Webdesign, die unverarbeitete Liebesbeziehungen (häufig mit
erotischen, ödipalen oder inzestuösen Inhalten) in zentraler Weise
chiffrieren.
Paranoide Webdesigner bevorzugen Formen und Farben, in
denen die zentralen Aussage in eine Opferrolle hineingerät, während bei
Manisch-Depressiven eine Oben-Unten-Thematik dominiert. Beiden
Patiententypen ist gemeinsam, dass sie einem wahllosen polychromatischen
Rauschzustand verfallen, um ihrer neurotisch motivierten Ästhetik durch
Sublimierung unverarbeiteter Konflikte Ausdruck zu verleihen. Für diese
Menschen gilt: Verlaßt euren Bildschirmarbeitsplatz und geht hinaus in
die Wälder und staunt über die einfachen Wunder der Natur. Anschließend
ist die Mitarbeit in einem farbethischen Arbeitskreis zu empfehlen als
therapeutischer Start in eine langwierige Heilbehandlung.
Prof. Dr. Ernst Blaubart
Direktor im Teuerpreis-Insitut
|
 |